Benutzer:Uslenried/Buch
Sternenfall
Zeichen vom Himmel
Herrschaft Ehrenfeld, 5. Boron 1039 BF
»Dann werden wir nun hinüber zum Kloster reiten und mit der Äbtissin sprechen. Zum Abendmahl sind wir sicher zurück.« Wulf wollte gerade die Hand zum Gruß heben als er innehielt.
»Hört Ihr das?« Sinya Phexiane, seine Gattin, schien zu lauschen; und auf einmal hielten sie alle still. Ein Brausen, wie ein stetiges Donnergrollen, war zu vernehmen, und mit jedem Augenblick wurde es lauter. Es kam aus dem Süden, doch sie mussten gegen die niedrig stehende Sonne blicken, und so konnten sie kaum erkennen, was sich da tat.
»Dort«, rief schließlich Kilea von Hagenau-Ehrendfeldt und deutete in Richtung der Sonne, die sich kurz darauf schlagartig für einen Augenblick verdunkelte. Das Brausen wurde derweil immer lauter, dann verstummte es mit einem lauten Knall.
»Was war d…?« setze Wulf zu fragen an, doch im gleichen Augenblick riss ihn ein plötzlich aufkommenden Sturmwind von den Beinen; den übrigen erging es nicht anders. Selbst die Pferde wurden zu Boden geworfen, und die Knechte hatten Mühe, sie zu halten.
Während sie sich wieder aufrappelten ertönte vom Kloster her der Gong; das Geräusch brachte einen fragenden Ausdruck in Kileas Gesicht. »Es ist nicht die Zeit dafür«, murmelte sie, wandte ihren Blick in Richtung des Klosters – und erschrak.
Eine Staubwolke erhob sich in der Richtung, in der das Kloster Sonnenau lag. »Praios bewahre«, murmelte Kilea. »Was immer es war, es hat das Kloster zerstört! Mutter!«
Die anderen sahen auf. Hinter der Staubwolke, die sich langsam verflüchtigte, konnte man die Klostermauern erahnen; auf diese Entfernung schienen sie jedoch intakt.
»Lasst uns losreiten und nachschauen, was geschehen ist«, versuchte der Baron die Lage zu entspannen. »Holen wir uns Gewissheit.«
»Reitet vor. In Anbetracht des Ereignisses werde ich nachkommen« sagte Orbert von Hagenau-Ehrenfeldt, der Gutsherr. »Schließlich muss ich auch wissen, was in meinen Landen vor sich geht«
Je näher sie dem Kloster kamen, desto sicherer waren sie, dass es unversehrt war. »Wahrscheinlich hat der Sturmwind den Gong geschlagen, vielleicht gar bis gegen das Mauerwerk«, mutmaßte Areana Bellenthor, die Hesindegeweihte.
Als sie wenig später das Kloster Sonnenau erreichten war dort alles in heller Aufruhr. Es war tatsächlich nichts schlimmes passiert; lediglich der Gong war von einer seiner Ketten gerissen und war gegen das Mauerwerk geprallt, welches aber offenbar lediglich Risse im Putz erlitten hatte. Die Stelle des unheimlichen Ereignisses lag hingegen an anderer Stelle – in Richtung des Trollgrabes.
Wulf atmete tief ein und versuchte sich zu beruhigen. Wenn das Trollgrab – jener Ort, den sie mit langen Nachforschungen und unter Nutzung der fast vergessenen geomantischen Kunst als den Ort der garetischen Heerschau erkoren hatten – davon betroffen war mochte das ein schlechtes Omen sein.
Also beschloss er kurzerhand, den Besuch bei der Äbtissin verschieben, wofür man im Kloster angesichts des Vorfalles Verständnis hatte, so dass sie sich auf den weiteren Weg machten und querfeldein die Strecke bis zum Trollgrab zurücklegten.
Schon auf halber Strecke bemerkten sie, dass die Umgebung sich veränderte: Erdbrocken und Grassoden bedeckten den Boden, und je näher sie kamen, desto mehr waren Gräser und Buschwerk in ihre Richtung umgeknickt. Dann sahen sie das Loch im Boden; einen Krater, wenige Schritte im Durchmesser.
Sie stiegen ab und pflockten die Pferde an. Vorsichtig näherten sie sich der neu entstandenen Senke. Sie war nicht ganz mannstief, und an der tiefsten Stelle klaffte ein dunkles Loch.
»Ein Hohlraum«, sagte Areana. Langsam, sich mit den Händen zusätzlich abstützend, kletterte, ja rutsche sie den Hang hinab in den Krater hinein.
»Sei vorsichtig!« Alcara, die Magierin, wirkte besorgt ob der Neugier ihrer Geliebten.
Die Hesindepriesterin spähte in das Loch hinein. »Man sieht nicht viel, doch das, was ich erkennen kann, sieht wie ein Gang aus. Er scheint in den Hügel zu führen!«
»In den Hügel?« Wulfs Interesse war geweckt. Vermutlich nannten man den Hügel nicht nur Trollgrab, sondern es verbarg sich tatsächlich etwas in seinem Inneren. Das mochte die Besonderheit des Ortes erklären, welche sie mit den geomantischen Stäbchen entdeckt hatten. Wenn es darin etwas gab, dann wollte er es wissen. »Wir brauchen Fackeln, Schaufeln und solche Dinge. Und ein paar kräftige Hände, die graben helfen…«

|
|
Das Innere Sanctum | ▻ |
| ◅ | Kors Klinge |
|
Das Innere Sanctum | ▻ |
| ◅ | Der rechte Ort – gefunden! |
|
Das Innere Sanctum | ▻ |
Das Innere Sanctum
Am Ehrenfelder Trollgrab, 5. Boron 1039 BF
Es hatte nicht allzu lange gedauert, ein paar Bauern und Werkzeuge aufzutreiben; Orbert von Hagenau-Ehrenfeldt, der Herr dieser Ländereien, ließ seinen Gästen alle erdenkliche Hilfe zukommen. Und letztlich war der Fall des Himmelssteins – und um einen solchen musste es sich hier gehandelt haben, da waren sich die Gelehrten unter Begleitern des Kronobristen inzwischen einig – ein besonderes Ereignis, an dem er teilhaben konnte, und somit eine willkommene Abwechslung zum sonst so tristen Alltag.
Das Erdreich war inzwischen weitestgehend aus der Grube geschafft worden, und die Bauern, die der Herr auf Ehrenfeldt dort unten schuften ließ hatten den Gang soweit freigelegt, dass man ihm in Richtung des Hügels folgen konnte. Die entgegengesetzte Seite war jedoch weiterhin verschüttet. Wulf stand am Rand der Grube und blickte hinab in die Dunkelheit. Ritter Orbert, der neben ihm stand, nickte bedächtig; dann hob er das Haupt und sah in den Abendhimmel. Es dämmerte bereits. »Ich denke, für heute ist es genug, nicht wahr?«
Wulf sah ihn fragend an. »Wie meint Ihr das?«
»Es dämmert bereits. Sie«, er wies auf die Bauersleut, »sollten zusehen, dass sie nach Hause kommen. Morgen ist ein neuer Tag.« Orbert winkte seinen Untergebenen erneut, und diese schickten sich an, ihr unverhofftes Tagewerk zu beenden.
»Ich hatte eigentlich gehofft, wir würden das Geheimnis heute noch lüften. Und wenn ihr mich fragt, der Gang ist nun frei genug, um zu erkunden, was dahinter liegt.«
Orbert von Hagenau-Ehrenfeldt schüttelte verständnislos den Kopf. »Ich steige bestimmt nicht in diese Grube hinab, nicht bevor ich sicher sein kann, dass keine Gefahr droht. Und heute ganz gewiss nicht mehr.« Das Interesse, das er noch am Nachmittag gezeigt hatte, schien verflogen.
»Ihr seid gar nicht neugierig?« Wulf versuchte, den Ritter aus der Reserve zu locken.
»Nur, wenn sich dort unten ein Schatz verbirgt. Doch wenn ich Euch richtig verstanden habe geht es doch um die mystische Vergangenheit dieses Ortes, nicht wahr? Und von Mystik wird man nicht im Säckel reich, sondern allenfalls im Geiste. Wenn überhaupt.«
»Wenn dies so ist… Ich denke, gerade die gelehrten Damen würden gerne noch etwas verweilen, um dem Ort seine Geheimnisse zu entlocken.« Wulf deutete mit einem Kopfnicken auf seine Hofmagierin, die zusammen mit der Hesindegeweihten und Larena abseits in einen Disput verwickelt war.
»Tut, was Euch beliebt. Außer alten Steinen und Knochen werdet Ihr eh kaum etwas finden, fürchte ich. Für meinen Teil ziehe ich mich auf das Gut zurück; die Nächte werden bereits kälter. Wenn Euch der Sinn anders steht, nur zu. Ansonsten kennt Ihr den Weg zu Eurer Schlafstatt, denke ich.« Damit wandte er sich ab und verschwand.
-
Die Neugier des Uslenrieders und seiner Begleiter war hingegen geweckt wie selten zuvor. Vielleicht lag es daran, dass sie als Geweihte einen anderen Blick auf die Dinge hatte und das Himmelsfeuer als ein Zeichen sahen, und auch Alcara konnte sich dem wissenschaftlichen Aspekt ihres Hierseins als Magierin nicht verschließen. Wulf hingegen glaubte zu spüren, dass diese Entdeckung etwas zu bedeuten hatte. Korgond und die Reliefsteine kamen ihm in den Sinn, doch dieser Ort mochte so gar nicht zu dem passen, was bislang über die gesuchte Stätte bekannt war. Dennoch fühlte er sich einem Ziel nahe, von dem er nicht wusste, was er war. Oder mochte es nur daran liegen, dass sie diesen Platz als Ort der Heerschau auerkoren hatten und nun ein derartiges Zeichen hier geschehen war? Er wollte es herausfinden.
Sie entzündeten Fackeln, dann stieg Jessa als erste die Leiter in die Grube hinab und trat einige Schritte in den Gang hinein. Die Handvoll Bauern, die am Tage hier gegraben hatten, hatten sich tunlichst zurückgehalten; der Hügel und seine Geheimnisse waren ihnen nicht geheuer. Und aufgrund der Tiefe des Loches hatte das Sonnenlicht auch nur die ersten paar Schritt in den Gang hinein noch ausleuchten können.
Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Jessa wieder am Schacht auftauchte. Der Krater, den der Himmelsstein in die Erde geschlagen hatte, war kaum zwanzig Schritte vom Rand des Hügels entfernt. »Der Gang sieht stabil aus, soweit ich das beurteilen kann, und er führt schnurgerade weiter, wie wir vermutet haben.«
»Also ins Innere des Hügels?« fragte Wulf.
»Ja, ganz sicher. Am Ende ist eine Art Felsentür.«
Nacheinander stiegen sie die Leiter hinab. Der Gang war über drei Schritt hoch und etwa zwei Schritt breit; Boden, Seitenwände und Decke bestanden aus aufgeschichtetem Felsgestein.
Wulf und Jessa, die vorne gegangen waren, besahen sich die Pforte. Sie bestand aus einer massiven Steinplatte; ein Schloss, Griff oder sonstwie gearteter Öffnungsmechanismus war nicht zu erkennen.
»Lasst mich einmal sehen.« Alcara, die Magierin, drängte ihre schmale Gestalt nach vorne. Sie legte die Hand auf die Tür und murmelte eine Formel. Sie hielt eine Zeitlang inne, dann ließ sie die Tür los. »Der Mechanismus ist magisch. Wenn ich recht liege, braucht man die Tür nur zu berühren, um sie zu öffnen; die Bedingung jedoch ist mir noch nicht klar. Auf meine Hand hat sie ja nicht reagiert.«
»Und wie kommen wir dann hinein?« Larenas vorlautes Mundwerk kam ihrer Neugier zuvor. »Probieren wir es einfach aus?« damit drängelte sie sich zwischen Jessa und Alcara hindurch und legte die Fingerspitzen auf den Fels. Nichts geschah.
»Damit hätten wir dann zwei erfolglose Versuche«, kommentierte Jessa trocken. »Folgt also der dritte.« Sie streckte die Hand aus, legte die Handfläche auf den Stein. »Und nun der nächste.« Sie sah ihre Begleiter an, doch jene starrten nur auf die Wand.
Dort, wo Jessas Hand den Fels berührt hatte, war ein Abdruck geblieben – rot wie Blut. Die Korpriesterin besah ihre Hand, doch an dieser war nichts zu erkennen.
Dafür setzte ein leises Grollen ein, und ein gezackter Riss bildete sich im Stein, als wäre er von oben nach unten gespalten. Langsam glitten die zwei Hälften der magischen Pforte seitlich in die Felswände des Ganges.
Larena pfiff durch die Zähne. »Das war ja fast zu einfach.«
»Das werden wir sehen. Aber verwunderlich ist es schon, ja.« Mit diesen Worten trat Wulf durch das Tor.
-
Hinter dem Durchgang öffnete sich eine kreisrunde Höhle, zumindest so weit man es erahnen konnte. Steinere Stelen trennten die Kaverne in einen äußeren Ring und einen inneren Kreis, doch Platz war zu beiden Seiten der Säulenreihe nur jeweils gute zwei Schritte. Das eigentliche Zentrum der Kaverne wurde von einer leicht pulsierenden grauen Blase eingenommen, über die immer wieder verschiedenefarbige Schlieren huschten.
»Eine alte Kultstätte«, stellte Kilea nüchtern fest, »von wem auch immer.« Sie leuchtete mit der Fackel umher; dann entdeckte sie die steinernen Halter in den Säulen und platzierte ihre Fackel dort.
»Und was ist das da?« Larena preschte wieder, von der Neugier getrieben, vor und stellte die Frage, die ihnen allen durch den Kopf ging.
»Nicht anfassen«, sagte Areana, die Hesindepristerin, und legte Larena die Hand auf den Arm; jene war drauf und dran, das graue Etwas zu berühren. Die Veränderung der Auswölbungen, welche die Blase schlug, erinnerte an einen Herzschlag, nur weitaus unregelmäßiger.
Wulf sah hinüber zu seiner Hofmagierin. »Irgendeine Idee, was das hier zu bedeuten hat?«
»Ein Tor in den Limbus; vielleicht auch eine Globule.« Alcara schien fasziniert. Sie schritt an der wabernden Blase entlang, Hand und Fingerspitzen ausgestreckt, als versuchte sie, das Geheimnis zu erspüren. Allerdings achtete sie darauf, dass ihre Finger nicht mit der wabernden Wand in Berührung kamen.
»Und wie kommen wir das durch?« Wieder war es die junge Nandusgeweihte – mit dem Kopf durch die Wand, wie Wulf amüsiert feststellte.
»Auch wenn es gallertartig oder wie eine Eihaut aussieht – ich denke, man kann hindurchtreten. Es ist eine magische Barriere, vielleicht auch ein Tor.« Alcara zögerte einen Augenblick. »Ich werde es versuchen.«
»Sicher?« Jessa war überrascht; die Magierin gehörte ansonsten keineswegs zu den Mutigen.
Alcara nickte, weitaus entschlossener, als ihre Begleiter es bislang von ihr gewohnt waren, »Wenn es eine magische Grenze ist, und davon bin ich überezugt, dann liegt es im Bereich des Möglichen, dass man nur durch den Einsatz von Magie wieder zurückkehren kann. Und jemand anderes als ich ist hier dazu nicht imstande.
Areana warf ihrer Geliebten einen vielsagenden Blick zu. »Sei vorsichtig«, war jedoch alles, was sie tatsächlich sagte, doch ihren Augen sprachen mehr.
Langsam nickte die Angesprochene, dann drehte sie sich um und ging auf die Blase zu.
-
Alcara trat durch das graue Wabern – und wurde wie von einer Gigantenfaust getroffen zurückgeworfen. Sie krachte gegen die Felswand, wo sie benommen und leise wimmernd liegen blieb; aus einer Platzwunde an ihrer Schläfe sickerte Blut.
Larena war als erste zur Stelle. Behutsam legte die den verrenkt daliegenden Körper der Magierin auf den Steinboden.
Areana Bellenthor, die Hesindepriesterin, hockte sich neben Larena und legte die Hand auf Alcaras Leib. Leise sprach sie die Worte eines Gebets, und augenblicklich entspannte sich der geschundene Leib der Magierin.
Langsam öffnete Alcara die Augen. Fragend sah sie die Versammelten an, kaum fähig sich zu rühren; es schien, als müsse sie sich erst einmal erinnern, was geschehen war.
»Was war das?« Larena konnte ihre Neugier wie üblich kaum zügeln und sprach aus, was sie alle dachten, doch noch nicht zu fragen gewagt hatten.
»Lasst ihr Zeit«, unterbrach die Hesindepristerin, »sie muss erst einmal zu sich kommen.«
Larena verzog die Mundwinkel; Geduld war eine ihrer weniger ausgeprägten Tugenden.
Wulf blickte nachdenklich hinab auf seine Cousine und Hofmagierin. Diese schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Es war, als hätte ich eine Stimme gehört, als ich die *Grenze* berührte.« Alcaras Stimme klang brüchig, schwach. Der Schlag, der sie getroffen hatte, hatte sie deutlich geschwächt.
»Eine Stimme? Hat sie etwas gesagt?« Areana, die den Kopf der Geliebten in ihren Schoß gebettet hatte, strich ihr sanft über die Stirn. »Erinnere Dich.«
»*Du bist vom rechten Blut, doch allein; Du bist das Falsche, doch nicht vereint zu zweien.*« Die Worte kamen langsam; es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Dennoch wiederholte sie den Spruch, mehrmals, von mal zu mal schneller werdend.
Die Versammelten sahen sich an. »Vom rechten Blut…«, murmelte Wulf.
»Liegt es nicht auf der Hand?« fragte Kilea von Hagenau-Ehrenfeldt, die Bannstrahlerin. Sie war den ganzen Tag bereits sehr schweigsam gewesen. Es beschäftigte sie, dass das Trollgrab, welches in unmittelbarer Nähe ihres Heimatklosters lag, offenbar magische Geheimnisse aufwies, von denen auch die Geweihten des Klosters Sonnenau über Jahrhundert nichts geahnt hatten. »Das richtige Blut. Stammlinien. Blutsverwandschaft.«
»Also unsere Familie?« hakte Larena nach.
Kilea nickte. »Ich denke ja, warum auch immer.«
»Also muss jemand aus unserer Familie dort hindurchschreiten«, stellte Larena fest. »Wenn Alcara nicht recht ist, bleiben ja nur Wulf, Sinya und ich.«
Sinya schüttelte den Kopf. »Ich nicht. Ich bin keine Streitzig.«
»Und wenn es *das Falsche* hieß, worauf bezieht es sich? Was unterscheidet Euch? Die Magie, die Weihe, das Geschlecht?« Kilea blickte auffordernd in die Runde.
»Es kann alles sein«, erwiderte Areana Bellenthor. »Und da war noch mehr. Vereint, zu zweit, waren das nicht die Worte?«
Alcara hustste, dann nickte sie, so gut es ging. »Ja.«
»Also müssen zwei hindurch«, sinnierte Wulf.
»Ganz recht, und zwar zwei, die verbunden sind. Ihr und Eure Gemahlin.« Die Hesindegeweihte sah zu ihm auf. »Ihr seid verbunden durch den Traviabund. Und beide geweiht, noch dazu Göttern, deren heilige Zahl dieselbe ist.«
»Und vereint durch das Blut, welches sich in Euren Kindern verbindet«. Jessa verschränkte die Arme vor der Brust; für sie schien festzustehen, dass nur dies die richtige Vorgehensweise sein konnte.
Sinya nickte, dann sah sie Wulf an. »Sie haben recht. Wenn hier jemand diese Bedingung erfüllen kann, dann nur wir. Lass es uns versuchen.« Sie sah ihrem Gemahl an, dass diesem nicht wohl bei der Sache war; nicht um seinetwillen, sondern ihretwegen.
Wulf atmete tief ein. »Nun denn. Offenbar haben wir keine andere Wahl, wenn wir hinter das Geheimnis kommen wollen.« Er nickte den übrigen zu, dann wandte er sich um und ging auf wabernde Blase zu; seine Gemahlin folgte ihm, stelle sich an seine rechte Seite.
Sinya ergriff seine Hand. »Vereint«, flüsterte sie. Dann traten sie vor, und das schillernde Wabern verschluckte sie.
1 — Fuchspfad
Obwohl sie zusammen hinein – oder hindurch – getreten waren, war er allein. Wulf blickte sich um, doch seine Gemahlin war nirgends zu erblicken. An den Rändern der Kaverne flackerten kleine Flammen wie von Öl- oder Talglichtern, und es reichte kaum, um den Mittelpunkt des Runds zu erhellen.
Suchend sah er sich um. Auch der Eingang der Kaverne war verschwunden; dennoch umrundete er einmal die gesamte Kaverne an ihrem Rand, um sicherzugehen, dass er sich nicht irrte. Schließlich trat er auf die Mitte der Kaverne zu.
Inmitten des Runds erhob sich ein grob behauener Felsblock, im schwachen Licht kaum mehr als schemenhaft zu erkennen. Langsam näherte er sich, und als er angekommen war sah er einen kleinen Gegenstand auf dem Felsblock liegen. Er griff mit der Linken danach und besah es sich genauer; es war ein Amulett in Form eine Fuchskopfes, wie auch Sinya eines trug. Nein, es war IHR Amulett!
In dem Augenblick, als die Erkenntnis durch seinen Kopf schoss, veränderte sich die Höhle; urplötzlich wallte dichter Nebel auf, ein blaugraues Leuchten erzeugte geisterschafte Schwaden.
Er spürte etwas hinter sich; Gefahr, mahne ihn eine Eingebung. Er zog das Schwert, fuhr dabei herum, und seine Klinge durchtrennte eine Nebelgestalt, die hinter ihm aufgetaucht war. Er machte einen Schritt vorwärts, und von den Seiten stürzten zwei weitere Nebelleiber auf ihn ein. Er ließ die Klinge über dem Kopf kreisen, ging in die Knie, und die Kreaturen vergingen, als die Schneide sie berührte.
Noch ein Schritt, dann noch einer, und zwei weitere. Dieses Mal nahm er die Gestalten eher war, und anders als die bisherigen trugen sie aus dem Nebel geschaffene Waffen; es waren drei. Ein Schlag hier, ein Stich dort, blocken, abwehren, ausweichen, noch ein Hieb, und auch diese Angreifer waren nicht mehr, vermengten sich mit dem bläulichen Nebel.
»Bemerkenswert«, wisperte eine Stimme aus dem Nirgendwo. Sie kam von überall zugleich. Wulf drehte sich suchend einmal um die eigene Achse, doch entdeckte nichts.
»Spürst Du sie?« hauchte die Stimme. Wulf hingegen antwortete nicht. Intuitiv wandte er sich wieder um und ging mit schnelleren Schritten als bisher in die Richtung, in welche er geblickt hatte, bevor die erste Nebelgestalt hinter ihm aufgetaucht war. Er brauchte nur ein halbes Dutzend Schritte, bis er die nächsten Nebelleiber erblickte; dieses Mal waren es vier. Er stürzte vor; sein Schwert durchbohrte die erste Gestalt, dann die zweite. Dem Hieb der dritten wich er gekonnt aus, setzte zu einem Konter an und durchtrennte den Nebelkörper in der Mitte. Eine Vierteldrehung, und seine Klinge raste auf die vierte Gestalt zu, auf Kopfhöhe.
Die Konturen der Gestalt verfestigten sich, es war – Sinya, doch auch ihr Leib war aus Nebel. Er riss die Klinge hoch; das Schwert fuhr haarscharf an ihrem Kopf vorbei; sie jedoch blieb regungslos.
»Du kannst sie nicht ewig beschützen«, flüsterte die Stimme.
Die Gestalt zerfiel, löste sich auf, zurück blieb nur der Nebel.
Die Blase zerplatze.
2 — Blutspur
Sie war allein. Sie stand am Rand der Kaverne, dort wo der Gang in die Höhle hineinführte, doch als sie sich umsah, war dort nur Stein. Suchend sah sie sich um, doch ein Ausgang war nirgends zu sehen. Stattdessen erblickte sie Spuren auf dem Boden.
Sie hockte sich hin und besah sich die Spur genauer. Die Abdrücke waren rotbraun, wie von getrocknetem Blut. Und die Abdrücke gehörten zu schmalen Stiefeln, sie mussten einer Frau gehören. Verstört streckte sie den linken Fuß vor und setzte die Sohle neben die Spur; es waren ihre eigenen Fußabdrücke. Fröstelnd erhob sie sich; sie hatte das Gefühl, als sei es in der Kaverne schlagartig kälter geworden. Langsam folgte sie der Spur.
Die Spur führte zu einem grob behauenen Felsblock, der in der Mitte der Kaverne stand. Etwas ruhte darauf, doch im Dämmerlicht konnte sie es nicht genau erkennen. Erst als sie näher kam, erkannte sie es – und erschrak.
Auf dem Stein lag der Kopf ihrer Schwester Silvana.
»Du hast sie getötet, erinnerst Du Dich?« Die Stimme kam aus dem Nirgendwo, von überall zugleich.
Sinya nickte; Tränen füllten ihre Augen. »Ich hatte keine andere Wahl...«
»Hattest Du nicht?« Nun war es der Schädel, der sprach. »Ich denke schon. Doch Du wolltest nicht!«
Sinya straffte sich. »Du hast uns verraten. Unsere Familie, unser Land; Du hast durch Deine Intrigen unsere Zukunft zerstört. Und nicht nur Du.«
»Pah, Du warst nur zu blind, die Zukunft zu sehen, kleine Schwester. Du hast nicht gesehen, was hätte sein können, hast nicht erkannt, welche Größe der Plan hatte.«
»Welcher Plan? Der Verrat, den ihr am Reich und an den Göttern begangen habt? Ein Land voller Tod, wo die Dämonen umhergehen? Ein Erbe gebaut auf dem Blut unserer Ahnen, dass Du selbst vergossen hast?«
»Mutter war schwach. Und Du bist es auch.«
»Ich bin stärker, als Du es jemals auch erahnen könntest. Stärker als Mutter je war.«
»Das glaubst Du. Doch Glaube ist trügerisch.«
»Ich weiß es. Und Dir habe ich es bereits bewiesen!« Zorn kochte in Sinya hoch; es fiel ihr schwer, sich zu beherrschen, doch es gelang.
»Ach, ein Zufall, reines Glück. Doch auch Dein Glück wird nicht ewig währen.«
»Was weißt Du schon davon? Du redest vom Glück, doch kennst nur Lug und Trug. Es war Dein Schicksal, die Strafe für Deine Taten zu finden. Ich bedaure lediglich, dass es durch meine Hand geschehen musste.«
»Siehst Du, dann bist Du nicht anders als ich. Auch an Deinen Händen klebt das Blut unserer Familie.«
Die Wut nahm überhand. Mit einem schnellen Streich wollte sie den Schädel vom Felsblock fegen, doch ihre Hand fuhr ohne Widerstand hindurch.
»Du widersetzt Dich Deinem Schicksal, forderst Dein Glück heraus, spielst um das Leben Deiner Familie – und immer hast Du gewonnen. Bisher.« Der Schädel, der einst Silvana war, grinste spöttisch. Dann spuckte er zwei Würfel aus, aus Bein geschnitzt. Klappernd rollten sie über den Steinboden, bis sie schließlich liegen blieben; der eine zeigte die vier, der andere die fünf.
»Neun«, sagte der Schädel. »Eine Zahl, die man nicht mit einem Würfel werfen kann. Auch ein Glück, dass mit Travia begann, wird mit Boron enden.«
Sinya blickte zu Boden, dann auf den Schädel ihrer Schwester, dann wieder auf die Würfel. Sie schwieg; Angst schnürte ihr die Kehle zu. Sie war versucht, die Würfel zu zertreten, mit einem Fußtritt von dannen zu schleudern, doch die Vernunft siegte.
Der Schädel verschrumpelte. Die Haare fielen aus, lösten sich auf; Haut und Fleisch vertrockneten, bis nur noch ein Totenschädel blieb. Schließlich zerfiel auch der Knochen zu Staub.
Die Blase verging.
3 — Die Prophezeiung der Neun
Der Nebel war verschwunden, doch anders als erwartet fand sich Wulf nicht am rückseitigen Ende der Kaverne wieder, sondern an der Stelle, an der er den Zugang hinter der Felswand vermutete. Die Talglichter, die zuvor die Höhle nur schwach erleuchtet hatten, waren verschwunden; an ihrer Stelle fanden sich nun Kristalle, die ein helles, warmes Licht abgaben, dessen Farbe zwischen silbrig und golden wechselte.
Dann stellte er fest, dass seine Hand leer war; Sinyas Amulett, dass er zuvor darin gehalten hatte, war verschwunden. Er war sich sicher, dass er es noch gehalten hatte, als die Blase geplatzt war.
Die Blase… Woher wusste er davon? Er sah sich um; von dem grauen Wabern und den Farbschlieren war nichts zu sehen. Und doch wusste er, dass sie vergangen war, wie ein sprichwörtlich geplatzter Traum.
Er sah auf. In der Mitte der Kaverne war der Stein, auf dem er zuvor das Amulett gefunden hatte. Ihr Amulett…
Wo mochte Sinya sein? Angst erfüllte seine Gedanken, doch er verdrängte sie; doch das Bild seiner Gemahlin blieb in seinem Geist präsent. In seinen Gedanken, seinen Wünschen, war sie bei ihm.
Langsam näherte er sich dem Stein, nach allen Seiten lauschend, die Augen immer in Bewegung. All seine Sinne sagten ihm, dass er nicht alleine wahr. Die Hand fuhr zum Schwertgriff, doch er zog die Klinge nicht. Noch nicht.
Ein Schatten sprang aus der Finsternis heraus in die Mitte des Runds. Mit katzenhafter Behändigkeit bewegte er sich, schien fast zu gleiten, und landete schließlich auf dem Stein.
Wulf sprang einen Schritt zurück. Das Wesen auf dem Fels hatte schwarzes Fell; es faltete ledrige, drachenartige Schwingen zusammen und legte selbige an den Körper. Der Schwanz hingegen war wenig katzenhaft, sondern glänzte chitinschwarz im schwachen Licht; der Giftstachel eines Skorpions.
»So bist Du also erschienen« sagte das Wesen, dessen Kopf annähernd menschlich war, doch auch fuchshafte Züge aufwies. Die dünne Mähne war von einem schmutzigen rotbraun, und unter der Nase standen lange Barthaare ab und wirkten wie Schnurrhaare.
»Erschienen?« fragte Wulf. »Das klingt, als wäre ich erwartet worden.«
»Ja und nein.« Das Wesen schüttelte den Kopf, so dass die dünnen Haare flogen, dann lachte es auf. »Du weißt, wer ich bin?«
»Ich weiß, was Du bist«, erwiderte Wulf; zugleich ließ er den Schwertgriff los.
»Das genügt.« Der Mantikor sprang mit einem Satz vom Steinblock.
»Tut es das? Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin, und was das hier für ein Ort ist.«
»Du bist hier, weil Du hier sein wolltest. Du selbst hast Dich hierher geführt. Ist es also nicht an Dir, zu sagen, was Du suchst?« Der Mantikor legte den Kopf schief und sah ihn erwartungsvoll an.
»Ich suche nichts. Es ist die Neugier, die mich antrieb.«
»Vielleicht suchst Du Dich selbst, ohne es zu wissen? Oder vielleicht wirst Du auch gesucht? Vielleicht bist Du nur ein kleines Steinchen auf dem Spielbrett des Lebens, eine Seele zwischen den Sphären? Ein Stolperstein für einen Giganten, eine lästige Fliege, die eines anderen Kopf umschwirrt? Weißt Du es?«
Während sie sprachen umrundeten sie den Steinblock; Wulf bewegte sich so, dass der Stein zwischen ihm und der Chimäre blieb.
»Der Stein dort, was hat es damit auf sich? Ist es einer der Altäre von Korgond?« Wulf hatte genug von den Fragen, er wollte Antworten. Also drehte er den Spieß um, vielleicht ließ sich ja sogar etwas herausbekommen.
»Ah, Korgond. Ein Ort, von dem ich einst hörte, danach also suchst Du. Glaubst Du, Du hast ihn gefunden? Nein, das glaubst Du nicht. Ist dies hier Korgond? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und selbst wenn es so wäre, was würde Dir das Wissen nützen?« Der Mantikor sprang auf den Stein; Wulf zuckte zurück.
»Ich weiß es nicht. Alle suchen danach.«
»Und warum?«
»Sie halten es für wichtig. Die Steine…«
Der Mantikor fiel ihm ins Wort. »Pah, Steine, was soll man schon damit. Wenn Du weißt, was Du bist, brauchst Du keine Steine. Oder willst Du Deine Gegner mit neun Steinen bewerfen?« Die Chimäre lachte; es klang nach Brüllen und Fauchen zugleich. »Was Du brauchst, ist etwas anderes. Etwas anderes, das schon einmal von Deinesgleichen geführt wurde, vom selben Blut. Vollende, was andere begonnen, wenn Du darum weißt.«
»Was weiß ich schon, wovon Du sprichst? Sag es mir, wenn ich es wissen sollte.«
»Du weißt um die Neun Streiche«, stellte der Mantikor fest.
Wulf nickte. »Man hat sie mich gelehrt«, erwiderte er.
»Mann? Oder doch eher Frau?« Der Mantikor grinste und entblößte ein mehrreihiges Gebiss.
»Spielt es eine Rolle?«
»Nein, natürlich nicht. Doch bist Du stark genug im Glauben? Bist Du stark genug für den Kampf um das, was Du bist?«
»Ich bin, was ich bin; mein ganzes Leben habe ich darum gekämpft, ich selbst zu sein.«
Der Mantikor schlich um ihn herum, wie Katzen um die Beine schleichen. »Bist Du bereit, das aufzugeben, was Du warst, und bereit, das zu werden, was Dir bestimmt ist?«
Wulf, der sich mit den Bewegungen des ihn umschleichenden Mantikors mitgedreht hatte, verharrte. Sein im Kloster St. Ancilla gegebenes Versprechen kam ihm in den Sinn; er hatte Yacuban von Creutz-Hebenstreyt zugesichert, sich nach den kommenden Schlachten zu offenbaren und in den seiner Weihe gebührenden Stand des Klerus überzutreten. »Ich habe es versprochen.«
»Bist Du willens, das zu tun, was Du tun musst, und gewillt, Dein Zutun als Dein Schicksal zu akzeptieren?«
»Sind unsere Pfade nicht vorgezeichnet? Könnte ich mein Schicksal erkennen und mich dagegen auflehnen, wenn ich darum wüsste? Kannst Du es?« Der Mantikor sprang zu Seite. »Manchmal ist das Schicksal ein mieser Verräter. Und Du weißt, wie es Verrätern ergeht. Doch wie dem auch sei, dem Schicksal entkommt man nicht; nicht ich, nicht Du, nicht jemand anders; nicht einmal die Götter können ihrem Schicksal entfliehen.«
Der Mantikor sprang auf Wulf zu, richtet sich auf den Hinterbeinen auf; ihr Gesichter waren kaum mehr als zwei Handbreit voneinander entfernt. Wulf roch den Atem der Chimäre, nach Fleisch, nach Blut, nach Tod.
»Bist Du im Stande, die Wahrheit zu sehen? Bist Du auch imstande, sie zu verstehen?« Der Mantikor ließ sich auf alle viere nieder, dann sprang er wieder auf den Stein.
Wulf stutze, wusste nicht, was er darauf antworten sollte.
Der Mantikor machte eine Bewegung mit der Pfote, als wolle er etwas wegwischen. Die glitzern leuchtenden Kristalle lösten sich von den Wänden, und begannen Irrlichtern durch die Kaverne zu schweben, umrundeten ihn, den Mantikor, den Felsblock.
»Siehst Du die Wahrheit?« fragte die Chimäre durch das leuchtende Glitzern. »Oder bist Du geblendet vom Licht der Sterne, von ihrer Schönheit?«
Die leuchtenden Kristalle wurden langsamer, doch sie verharrten nicht. Sie ordneten sich neu; wie eine leuchtende Wand aus Sternen schwebten sie im Raum; sie beschrieben Schleifen und Striche, schneller als das Auge ihnen folgen konnte, und ließen Schriftzeichen aus Licht entstehen. Es dauerte eine Weile, bis Wulf sich an das Flirren gewöhnt hatte, doch dann stand ihm die Sternenschrift klar vor Augen, und die Worte brannten sich in seinen Geist.
- Neun werden die Streiche führen,
- Wenn sich wandelt die Verderbnis zum Gegenteil,
- Die List der Vielgestaltigen Bande bricht.
- Denn das Blut des Wahrhaften ist Wehr und Waffe zugleich,
- Wo aus den Höllen sucht heim der Vergangenheit Finsternis.
- Was neunfach vereint kann die Finsternis besiegen,
- Wenn Geeintes Blut aus dem Dunkel streichend,
- Unter dem nächtlichen Schatten die Schrecken begräbt,
- Das finale Opfer die Seelen erlöst.
»Was bedeutet das?« murmelte Wulf, mehr zu sich selbst.
»Das musst Du schon selber herausfinden – und glaube mir, Du wirst es auch!«
Die Schrift verblasste, Dunkelheit fiel zurück in den Raum; der Mantikor verschmolz mit den Schatten.
Die Blase zerplatze erneut.
4 — Das Sternenrätsel
Sie fühlte sich in den Raum hineingestoßen, und als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten erkannte sie die Kaverne. Ein schwachen Lichtschein von Gwen-Petryl-Steinen ließ sie kaum mehr als Schemen erkennen. Suchend blickte sich Sinya um, drehte sich an Ort und Stelle einmal langsam um die eigene Achse und stellte fest, dass sie sich wieder am Zugang der Höhle befand, doch die Pforte war immer noch verschwunden.
Langsam näherte sich der Mitte der Kaverne; mit kleinen Schritten, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend.
Ein schwaches Funkeln ließ sie innehalten. Sie sah nach unten und erkannte einen kleinen Kristall; sie hockte sich hin, betrachte den im kalten Licht der Efferdsteine kaum funkelnden Edelstein und hob ihn schließlich auf.
Kaum dass sie den Kristall berührte schoss ein Bild durch ihren Geist; eine Wand von Sternen, die vom Himmel fiel und klirrend auf den Steinboden der Kaverne stürzte. Wann immer einer der Sterne den Boden berührte gab er ein glockenhelles Klingen von sich. Dann verblasste die Eingebung.
In der Hocke bewegte sie sich vorwärts, dabei sammelte sie alle Kristalle ein, die sie fand; bald waren es so viele, dass sie ihren Umhang schürzte und die Kristalle hineinsammelte.
»Die Sterne sind vergangen, sie leuchten nicht mehr in der Nacht. Wer sie vereint, der findet Macht.« Die Stimme aus dem Nichts, von überall zugleich wisperte durch den Raum.
Sinya erhob sich; suchend sah sie sich um, doch sie fand niemanden. Das fahle Licht der Gwen-Petryl-Steine erinnerte sie an Mondenschein, doch das Bild, dieser Gedanke sie in ihrem Geist weckte war unvollständig. Etwas fehlte.
Ihr kam ein Gedanke. Sie ergriff einige der Steine und begann, sie auf dem Boden auszulegen. Einer hier, ein weiterer dort, ab und an rückte sie einen Stein um eine Winzigkeit weiter. Ein Bild entstand, mehr vor ihrem Inneren Auge als in Wirklichkeit. Als sie fertig war begannen die Kristalle des Motivs schwach zu leuchten; es war das Sternbild des Fuchses. Und sie verstand.
-
Stück für Stück legte sie aus den Kristallen den Nachthimmel auf dem Boden aus, und wann immer sie ein Sternbild fertig gestellt hatte, beganne die zugehörigen Kristalle schwach zu leuchten. Schließlich hatte sie die Aufgabe vollbracht; die Anzahl der Kristalle war genau aufgegangen, doch nichts geschah. Hatte sie einen Fehler gemacht? Stück für Stück besah sie ihr Werk, dann stutzte sie. Der Kristall, der das Auge des Drachen bildete strahlte nicht, sondern blieb dunkel.
Sie bückte sich und griff nach dem Stein. Als sie den Kristall an sich genommen hatte, blitzen die Sternbilder hell auf. Geblendet schloss sie die Augen, und mit einem Mahl fühlte sie sich unendlich frei, als würde sie schweben.
Die Blase verging erneut.
5 — Der Fall
Er trat ein weiteres Mal in die Kaverne. Noch bevor er sich umdrehte wusste er, dass der Eingang verschlossen sein würde, dennoch warf er eine Blick über die Schulter. Entschlossen trat er vor.
Der Mantikor stand am Felsblock, die Vorderbeine auf den Stein gestützt; er wirkte gelangweilt.
»Es ist doch immer wieder das gleiche. Die Zeit verrinnt, die Jahre gehen dahin, die Äonen fliehen vorbei.«
»Und was tust Du?«
Der Mantikor lachte. »Ich warte.«
»Warten? Worauf?«
»Darauf, das Dinge geschehen. Dinge, die Dein Geist nicht begreifen könnte, selbst wenn Du ihrer ansichtig würdest.«
»Das kannst Du nicht wissen.«
»Oh doch, dass kann ich. Ihr derischen Wesen wollt so klug sein, doch seid ihr nicht einmal in der Lage, Euch selbst zu erkennen. Ihr streitet um die Vorherrschaft, und doch ist es Euch vorherbestimmt, einst unterzugehen, ganz gleich, ob ihr Fell, Schuppen oder spitze Ohren habt – oder auch nicht.«
»Aber Du, Du glaubt, alles zu wissen? Über uns Menschen, über die Elfen, die Schwarzpelze?«
»Menschen, Elfen, Orks, Trolle, was spielt das schon für eine Rolle? Selbst die Zwerge sind aus anderem Stein geschlagen; das Land ist älter, als sie sagen. Oh, das reimt sich, und was sich reimt ist gut – oder vielmehr wahr. Du kennst das Zusammenspiel zwischen Blut und Land, zwischen Macht und Stein, zwischen Herrschaft und Verantwortung, Dienst und Pflicht?«
Wulf nickte, erinnerte sich an lange zurückliegende Zeiten. Der Greifenstein im Hof der heimatlichen Burg trat vor sein inneres Auge. Der Bund, besiegelt mit seinem Blut…
»Du weißt, was Deine Pflichten sind? Oder muss man Dich dran gemahnen? Du schreitest eine Pfad dahin, der auf zwei Seiten eines Abgrunds entlangführt.«
Vor ihm, unter ihm öffnete sich der Steinboden; ein dunkler Riss, breiter und breiter werdend, tat sich auf. Wulf drohte das Gleichgewicht zu verlieren; er sprang beiseite und kam am Rand des Abgrunds zum Stehen. Keuchend rang er nach Atem.
»Der Abgrund wird breiter. Du wirst nicht mehr lange zwischen beiden Seiten hin- und herspringen können, wie es Dir beliebt. Es wird der Tag kommen, an dem Du Dich für eine Seite entscheiden musst. Kannst Du das? Willst Du es auch?« Der Mantikor sah ihn an, doch Wulf schwieg, unschlüssig.
»Du wirst lernen müssen, dass nichts mehr sein wird, wie es war. Nach dem Aufstieg kommt der Fall.«
Wulf fühlte ein Schlag auf den Rücken, wie von einer Keule; der Skorpionstachel des Mantikors hatte ihn mit voller Wucht getroffen. Er stolperte, nach vorne, über den Abgrund.
Er fühlte, spürte, wie er fiel.
Wieder zerplatze die Blase.
6 — Die Prophezeiung der Sterne
Sie trat aus dem Nebel – und fand sich in der Kaverne wieder. Tief im Inneren hatte sie bereits damit gerechnet, und so nahm sie es hin. Suchend sah sie sich um, doch sie war allein; die Höhle war leer. Sie stand am Rand, und so machte sie vorsichtig einen Schritt vorwärts.
Etwas tropfte von der Höhlendecke. Sie hörte es, dann spürte sie etwas Feuchtes in ihrem Gesicht. Mit der Linken wischte sie es fort; als sie auf ihre Finger blickte stellte sie fest, dass es Blut war.
Sie verharrte, dann trat sie einen Schritt zurück. Überall fielen nun Tropfen von der Decke und bildeten rote Rinnsale auf dem Boden. Sie flossen ineinander, bildeten verschlungene Zeichen, und veränderten sich wieder. Vorsichtig trat Sinya vor, näherte sich dem Blut, dass sich Schriftzeilen gleich um den Felsblock herum bewegte, und besah sich die Zeihen genauer. Es war eine Schrift, fließend, aus Blut. Sie versuchte, die Worte zu entziffern, doch die Bewegung war zu schnell. Also hockte sie sich hin, konzentrierte sich auf einzelnen Worte, und nach und nach bildeteten sich Sätze in ihrem Geist, die sie wieder und wieder rezitierte, bis sie sicher war, den Text verinnerlicht zu haben, der sich immer und immer wiederholte:
- Wenn auf Fuchspfaden schreitet der Mantikor,
- zu schützen was glänzt im Mondenlicht,
- Seine Fährte führe auf Deiner Spur, bevor Du selbst sie gegangen.
- Denn der Pfad der Sterne weist den Weg in das Innerste,
- Wenn aus den Höllen sucht heim der Vergangenheit Finsternis.
- Was geeint im Herzen kann die Finsternis besiegen,
- Wenn Geeintes Blut aus den Nebeln schreitend,
- Unter dem nächtlichen Schatten die Schrecken begräbt,
- Das finale Opfer die Seelen erlöst.
Schweigend erhob sie sich; ihr war heiß und kalt zugleich.
»Hast Du verstanden?« wisperte die Stimme aus dem Nichts.
Sie nickte. Die Zeichen aus Blut verschwammen, lösten sich auf und versickerten im Boden.
Wieder verging die Blase.
7 — Der Gute Kampf
Der erwartete Aufprall blieb aus. Stattdessen spürte er mit einem Mal wieder den Boden unter den Füßen und stellte fest, dass er stand. Er öffnete die Augen – obwohl er sich nicht erinnern konnte, sie geschlossen zu haben – und fand sich erneut in der Kaverne wieder.
Der Mantikor saß auf seinen Hinterbeinen neben dem Felsblock. Sein Skorpionschwanz bewegte sich hin und her, die der Schwanz eines Hundes. Die Zunge leckte über die Lippen, dann öffnete er das Maul zu einem leichten Grinsen; die Zähne waren blutig.
»Wie ich sehe, bist Du wieder da. Hast Du auch das also verkraftet.«
Wulf schwieg. Was sollte er auch antworten?
»Du schweigst. Hast Du nichts zu sagen? Hast Du Dich entschieden? Oder willst Du weiter auf schmalem Grat wandern, bis Du fällst? WAS bist Du?« Die letzten Worte klangen einem Donnerhall gleich durch die Kaverne.
Wulf fiel auf das Knie; er zog sein Schwert, umfasste mit der linken Hand die Klinge und drückte zu, bis Blut an der Schneide hinabrann. »Ich bin ein Diener des Herrn, Gefolgsmann des Herrn der Schlachten, der lachend durch die Reihen der Heerscharen schreitet und blutige Ernte hält unter jenen, die eines Guten Kampfes nicht würdig sind.«
»Und hast Du jemals einen Guten Kampf gekämpft?« Der Mantikor warf den Kopf zurück, er bleckte die Zähne.
»Nein.«
»Dann ist es an der Zeit, dass Du Dich als würdig erweist.« Mit einem Satz sprang die Chimäre herbei und landete dort, wo Wulf noch einen Augenblick zuvor gekniet hatte. Geistesgegenwärtig hatte er sich jedoch zur Seite geworfen, schnellte aus dem Stand wieder hoch und beschreib dabei mit der Klinge einen Bogen; das Schwert verursachte einen tiefen Schnitt in der ausgebreiteten Drachenschwinge. Den heranrasenden Skorpionschwanz nahm er nur aus den Augenwinkeln war; er ließ sich fallen, rollte sich ab, doch kaum dass er stand traf ihn einen der Schwingen und warf ihn Boden. Der Sturz presste ihm die Luft aus den Lungen, dennoch stemmte er sich hoch.
Der Mantikor fuhr herum; Wulf parierte den Hieb der Klaue mit der Klinge; der Stahl fuhr tief zwischen die Krallen. Den Schlag der anderer Klaue der Chimäre bemerkte er jedoch erst, als die Krallen in sein Bein fuhren. Er sprang zurück, holte aus, versuchte Hieb um Hieb, Stich um Stich zu setzen. Der Mantikor brachte ihm zwei weitere Treffer bei, bevor er selber eine erfolgreiche Attacke vollbringen konnte.
Ausweichen, parieren, zurückspringen, zuschlagen – die Abfolge der Angriffe wirkte wie ein skurriler Reigen, ein Tanz auf Leben und Tod. Er landete Treffer, doch musste er auch selber welche einstecken; im Geiste versuchte er mitzuzählen, denn er ahnte, dass der neunte Hieb den Todesstoß bedeuten sollte.
Irgendwann war er bei acht. Acht erfolgreichen Hieben für ihn, sieben Treffer hatte er einstecken müssen. Nun ging es um alles. Ein weiterer Treffer, der es entscheiden musste, ein erfolgreicher Angriff…
Der Gedanke hatte ihn abgelenkt. Der Mantikor fuhr fauchend herum, eine der Drachenschwingen schmetterte ihn zu Boden. Das Schwert entglitt seinen Händen, rutsche klirrend über den Stein.
Der Mantikor lachte hämisch. »Dein erster Guter Kampf, und wie mir scheint, wird es auch Dein Letzter sein.« Die Chimäre breitete die Schwingen aus, setzte zum Sprung an, einem drohenden Schatten gleich glitt sie heran, bereit, sein Ende einzuläuten.
»Tu es jetzt.« Eine Stimme – Sinyas Stimme – klang wie ein sternenhelles Lachen in ihm. Blitzschnell schnellte er unter dem Leib seines Gegners hindurch; mit kratzendem Geräusch landeten die scharfen Klauen auf dem Stein.
Er sprang auf, stürzte sich mit einem übermenschlichen Satz auf die Chimäre und riss deren Kopf nach hinten, bis es knackte. Mit gebrochenem Genick sackte der Mantikor zusammen und erschlaffte.
Wulf ließ sich schwer atmend fallen. Der Kampf war vorüber. Doch war er rechtens gewesen? War nicht der Mantikor ein heiliges Wesen seines Gottes? Oder war dieses Wesen der Verderbnis entsprungen, mit seinen Schwingen und dem Fuchsgesicht? Er wusste es nicht.
Vorsichtig setzt er sich auf; jetzt, da der Kampf vorüber war, spürte er den Schmerz in jeder Faser seines Körpers. Im Geiste zählte er nach; acht Streiche mit dem Schwert hatte er dem Wesen beigebracht, und es dann nur mit seinen Händen getötet. Neun also. Dennoch zog er den Dolch, ritzte die Handfläche und ließ die neun Blutstropfen auf den Boden fallen, wie Jessa es ihn gelehrt hatte.
Und als der letzte Tropfen den Boden berührte zerplatze die Blase.
8 — Die Falsche Schlange
Sie erwachte, wie aus tiefem Schlaf. Sie brauchte sich nicht umzusehen, um zu wissen, wo sie sich befand, und ebenso wenig suchte sie nach der Pforte im Stein, von der sie wusste, dass sie nicht zu finden war. Sie fühlte sich benommen, wie an einem Morgen nach zu viel süßem Wein; ihr Blick war trüb; sie blinzelte, als sie die Augen öffnete.
Die Kaverne war in angenehmes, helles Licht getaucht. Fackeln warfen flackerndes Licht in des Rund, und von der Decke herab strahlte ein Abbild des Sternenhimmels silbriges Licht in den Raum. Mühsam richtete sie sich auf – und erschrak. Ein pelziges Gesicht tauchte vor ihr auf, so dass sich die Nasenspitzen fast berührten. Sie zuckte zurück, krabbelte einige Handbreit rückwärts; dann hielt sie inne.
Vor ihr hockte ein Mungo; zumindest hielt das Tier, das nun vor ihr auf den Hinterbeinen hockte für einen solchen. Gesehen hatte sie in ihrem Leben noch keinen, doch sie kannte Bilder aus dem alten Buch ihrer Familie und wusste daher, dass der Mungo in anderen Landen als heiliges Tier des Nächtlichen galt, so wie man in den Mittellanden den Fuchs als Phexens Tier ansah.
»Hier, trink noch den letzen Schluck, dann wird es Dir besser gehen.« Der Mungo hielt ihr eine Phiole entgegen; in dem gläsernen Röhrchen schwappte der Rest einer klaren blauen Flüssigkeit.
»Was ist das?« fragte sie.
Der Mungo lächelte; zumindest wirkte es so. »Ein Antidot. Es hat Dich gerettet, denke ich. Das, was fehlt, habe ich Dir bereits eingeflößt; wer weiß, ob Du sonst noch währest.«
»Ein Antidot? Warum?« Sie verstand nicht.
»Ein Antidot eben. Gegen das Gift. Erinnerst Du Dich nicht?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dann nimm und trink.« Der Mungo streckte ihr die Pfoten entgegen, mit denen er noch immer die Phiole hielt.
Sie ergriff das Röhrchen, betrachtete es kurz und schüttelte den Kopf. Dann setzte sie es an die Lippen und trank; die Flüssigkeit schmeckte bitter, sie schüttelte sich. »Bah., ekelhaft.«
»Aber es hilft. Ohne das Antidot währest Du gestorben. Doch es sollte nicht sein.«
Sie setzte sich auf. »Erzähle mir, was geschehen ist. Bitte.«
Der Mungo wiegte den Kopf. »Nun, wenn Du Dich wirklich nicht erinnerst… Die Schlange hat Dich gebissen, gleich, als Du angekommen bist. Du hast sie wohl nicht gesehen. Das Gift drang in Dich ein, und Du bist umgefallen, einfach so.«
»Und die Schlange? Wo ist sie jetzt?« Sie mochte Schlangen nicht und fürchtete, es könnte erneut geschehen, was ihr gerade widerfahren war.
»Weg. Sie hat sich verkrochen. Wie sie es immer tut.«
»Wie sie es immer tut?«
»Ja, wie immer. Sie verkriecht sich in Löchern und Ritzen, wenn sie ihr Gift verspritzt hat, bevor das Spiel von Neuem beginnt.« Der Mungo redete, als sei das, wovon er sprach, das natürlichste der Welt.
»Ein Spiel… Ihr spielt ein Spiel?«
»Wenn Du es so nennen willst. Ein ewiges Spiel auf Leben und Tod, jeden Tag aufs Neue. Vielgestaltig ist die Finsternis, und nur List und Glück können sie besiegen.«
»List und Glück…«
»Ja. Komm mit.« Damit drehte er sich um und sprang von dannen, bis er den Steinblock erreichte. Mit einem Satz landete er auf dessen Oberfläche.
Sinya stemmte sich in die Höhe, die leere Phiole noch in der Hand. Dann folgte sie dem Mungo mit langsamen Schritten.
-
Als sie am Felsblock angelangt war reichte die dem Mungo die Phiole. »Danke«, sagte sie.
»Oh, da nicht für«, erwiderte das Tier, legte die Phiole auf den Stein, wo diese verblasste. »Ich habe nur getan, was ich tun musste. Das Leben ist ein Rinnsal, die Welt ein Fluss. Es war nur ein Tropfen im Strudel der Sphären. Leben ist Veränderung, weißt Du? Und auch die Sphären verändern sich, ebenso wie wir. Nicht einmal die Götter können etwas an ihrem Schicksal ändern.«
Sie schwieg und ließ ihren Blick schweifen. Schließlich verharrten ihre Augen an der Höhlendecke, wo die Sternbilder leuchteten. »Selbst der Himmel verändert sich. Ist es das, was Du meinst?«
»Der Drache blind, das Schwert wird stumpf, Feuriger Stern macht Wasser zu Sumpf.« Er kicherte. »Ein Reim, schnell dahingeschüttelt. Die Welt, aufgerüttelt.«
»Du sprichst in Rätseln.«
»Tue ich das? Öffne die Augen, und Du wirst sehen. Öffne die Ohren, um zu verstehen. Du bist nicht allein.« Er lauschte. »Wir hier im übrigens auch nicht mehr. Damit sprang er vom Stein.
-
Sinya hörte das Zischeln; erst leise, dann immer lauter werdend drang es an ihr Ohr. Schwarze Schatten huschten den Säulengang am äußeren Rand der Kaverne entlang, wurden dichter und dichter. Das Zischeln wurde immer lauter, und es kam von überall zugleich. Dann begannen die Schatten zu verschmelzen, auch das Zischeln kam nicht mehr von überall, sondern konzentrierte ich auf den Punkt, an dem die Schatten sich verbanden und mehr und mehr Gestalt annahmen.
Dann war es vorbei. Die Schatten verblassten und gaben den Blick frei auf eine armdicke, etwa einen Schritt lange Schlange; ihre schwarzen Schuppen glänzten feucht. Zischend schlängelte sie sich in die Mitte des Rondells; Sinya wich instinktiv einen Schritt zurück.
»Da issst ja der Sssternendieb«, zischelte die Schlange. Sie verharrte, richtete kobragleich den Kopf auf und starrte Sinya und den Mungo aus gelben Augen an. »Gib esss zssurück; esss gehört nicht Dir.«
»Das hast Du nicht zu entscheiden.« Der Mungo sprang zwischen Sinya und die Schlange.
»Wer sssagt dasss? Du? Du weißsst ja nicht einmal, wasss Veränderung ist. Vielleicht sssolltessst Du esss lernen, um zu verssstehen.« Sie stieß mit dem Kopf vor, doch der Mungo wich ihr geschickt aus.
»Versssuche esss erssst gar nicht. Für heute hassst Du einmal gewonnen, esss kann kein zssweitesss Mal geben. Dasss weißsst Du auch!«
»Wissen ist Macht«, ätzte der Mungo, »und Du weißt nichts.« Dabei sprang er über den Schlangenkopf hinweg, um zuzubeißen, doch die Schlange rollte sich zur Seite. Dabei veränderte sie sich; zuerst erschienen rote Muster auf ihrer schwarzen Haut, dann färbte sich das Schwarz nachtblau.
»Wissssen issst Veränderung. Du veränderssst nichtsss.« Wieder stieß der Schlangenkopf in Richtung des Mungos; dieser machte einen Satz rückwärts. Die Schlange verblasste, ihre Haut wurde nahezu durchsichtig, so dass man ihr Inneres sehen konnte; dann wurden die Schuppen weiß und graue Muster, Schriftzeichen ähnlich, zeigten sich darauf. »Und nun gib Du zssurück, wasss Du gessstohlen hassst!« Drohend wandte sie sich Sinya zu, dann verdoppelte sie innerhalb weniger Augenblicke ihre Länge und Dicke; an ihrem Schwanzende bildeten sich die Ringe einen Klapperschlangenschwanzes.
»Ich habe nichts gestohlen!« Sinya wich einem Angriff der Schlange aus; dabei zog sie Rapier und Parierdolch.
»Doch. Du bissst eine Diebin, und wasss Du nun hassst, issst nicht Dein, sssondern unssser. Gib esss zssurück, oder Du wirssst sssterben! Die Ssspur der Sssterne issst unssser Geheimnisss, und Du Fuchsssssschatten hassst esss gessstohlen!« Wieder schnellte sie vor; Sinya wich zur Seite aus, führte zwei, drei schnelle Stiche aus, jedoch ohne zu treffen. Dann war der Mungo zur Stelle, doch die Schlang ließ den Kopf fallen, so dass er über sie hinwegsprang, ohne sie berühren zu können.
Ein erneuter Vorstoß der Schlange, eine Parade, ein Hieb mit der Klinge; ausweichen, vorstoßen, zurückspringen. Mal ein Treffen, dann wieder nicht. Auch der Mungo wurde nicht müde, hüpfte mal hierhin, mal dorthin, traf jedoch nicht. Sinyas Atem ging schnell; sie fühlte Schwere und Müdigkeit in ihren Gliedern; eine Wirkung des Giftes? Sie stolperte ein paar Schritte rückwärts, während der Mungo in die Lücke sprang, als wolle er sie schützen.
Die Schlange veränderte sich erneut. Erst wuchs sie in den Länge, dann wechselte sie ihre Farbe, schließlich wuchsen ihr kurze Beine; erst vier, dann acht, dann sechzehn. Nach einem weiteren Farbwechsel – der Kopf wurde rot, der übrige Körper schillerte in Streifen von grün, gelb und blau – häutete sie sich und war wieder nur einen Schlange, doch anstatt des Schwanzes trug sie nun an ihrem Ende den Kopf einer Natter, während sich an ihrem Anfang drohend der Kopf einer Kobra aufrichtete. Der Mungo war währenddessen unablässig in der Kaverne umhergesprungen, während die Schlange ihm folgte, und hatte nahezu spielerisch versucht, sie zu fangen, doch ohne Erfolg.
Sinya hingegen war der Kreatur ausgewichen, wann immer sich der Schlangenkopf in ihre Richtung bewegt hatte. Nun war es wieder so weit. Der Kobrakopf schnellte vor, sie sprang zurück, doch die giftigen Zähne zuckten bereits wieder in ihre Richtung. Der Mungo aber war zur Stelle, als hätte er nur auf diese Gelegenheit gewartet, und schlug die Zähne in den Schlangenhals. Der Kobrakopf ruckte zurück, erschlaffte und fiel zu Boden.
Triumphierend erhob sich der Mungo auf die Hinterbeine und bleckte die Zähne; dann jedoch zuckte er unversehens zusammen. Der Natternkopf hatte sich in seinem Nacken verbissen.
»Jetzt, der letzte Streich«, klang die vertraute Stimme Wulfs ; sie hatten dasin ihrem Geist, in ihrem Herzen. Sinya schnellte mit mit einer fließenden Bewegung vor; ihr Rapier durchtrennte den Schlangenleib kurz hinter dem Kopf, doch die Klinge traf auch den Mungo. Während die Schlange vollends erschlaffte rannen Fäden von Blut vom Rücken über das Fell des Mungos, doch jener schien die Verletzung nicht zu spüren.
»Zu spät«, sagte der Mungo grinsend. »Das Gift war bereits in mir.«
»Das Gift? Es war eine Natter…« Sinya war verwirrt.
»Manche Schlangen sind falsch«, erwiderte der Mungo. »Du wirst es erkennen, wenn es soweit ist. Manchmal muss man Opfer bringen, bevor es zu spät ist; lerne daraus.« Damit sackte er zusammen.
Und die Blase verging.
9 —Vereint
Dieses Mal waren sie nicht allein. Sie spürten es, bevor die Finsternis wich, bevor ihre Augen einander ansichtig wurden. Es reichten die Blicke, die sie einander zuwarfen, um zu wissen, dass sie unverletzt waren. Sie nickten sich zu, dann näherten sie sich mit langsamen Schritten dem Fels in der Mitte der Kaverne.
Ein Licht huschte aus den Schatten auf sie zu. Es kam aus der Richtung in der Wulf das Kloster vermutete. Einem Irrlicht gleich zog es in verwirrenden Bahnen eine leuchtende Spur durch die Kaverne, dabei wuchs es, bis es etwas über Kopfgröße angewachsen wurde, und auch das Strahlen nahm zu. Es strahlte, gleißte, doch ohne zu blenden, und dennoch reichte es nicht aus, die ganze Kaverne zu erleuchten, die die Ränder blieben im schummerigen Dunkel. Schließlich verharrte es schräg über dem Stein, ungefähr in der Richtung, aus der es gekommen war.
»Ihr seid eins«, wisperte das Licht. »Ihr wart dies immer, ihr solltet es werden, und ihr werdet es ein.«
Wulf und Sinya sahen sich an, dann das Licht.
»Alles, was noch fehlt, ist der Beweis«, klang es einer Melodie gleich in ihren Ohren.
»Der Beweis, der Beweis« murmelte Wulf. Er blickte zu dem Licht, zu Sinya, zu Boden.
»Wird sind eins«, murmelte Sinya. »Vereint.«
Ihr letztes Wort ließ Wulf aufhorchen. Dann nickte er, verstehend. Er öffnete die Hand, zeigte die Schnittwunde in der Handfläche. Nun war es Sinya, die nickte; sie griff zum Gürtel und umfasste den Griff ihres Dolches.
Wulf zog seinen Dolch ebenfalls. Sie taten den letzten Schritt auf den Stein zu, dann setzten sie die Klingen an ihre Handflächen. Doch noch bevor sie einen Schnitt vollziehen konnten huschte das Licht zwischen Ihnen hindurch.
»EINS!« donnerte es durch die Kaverne und ließ sie zusammenzucken.
Sinya streckte Wulf ihre Linke entgegen; ein Wimpernschlag reichte ihm, um sie zu verstehen. Also tat er es ihr gleich, dann setzte er seine Klinge an ihrer Hand an, ebenso wie sie es bei ihm tat. Neun Tropfen fielen von jeder Hand hinab, platzen auf dem Stein und vermengten sich dort zu einer einzigen, kleinen Lache.
»Geht, zu zweit, auf dem Euch bestimmten Weg«, sagte das Licht; dann wurde es von der Dunkelheit verschlungen.
Und die Blase zerplatze erneut, verging ein weiteres Mal.

| ◅ | Zeichen vom Himmel |
|
Das heilige Schwert | ▻ |
| ◅ | Zeichen vom Himmel |
|
Das heilige Schwert | ▻ |
| ◅ | Zeichen vom Himmel |
|
Das heilige Schwert | ▻ |
Das Heilige Schwert
Im Ehrenfelder Trollgrab, am 6. Boron 1039 BF, nach Mitternacht
Es war, als wenn sie durch grauen Nebel glitten; sie hatten das Gefühl, gleichzeitig zu gehen, zu stehen und zu fallen; dann lichtete sich der Nebel und machte der Finsternis Platz, doch nur einen Herzschlag später erleuchtete das Licht von neun Fackeln die Kaverne.
Sie standen vor dem Stein, nicht am Eingang der Kaverne, wie es zuvor immer der Fall gewesen war; alles war still. Lange sahen sie sich in die Augen, dann senkten sie den Blick hinab, dorthin, wo sich vor gefühlten Äonen ihr Blut vermischt hatte.
Die Lache aus rotem Lebenssaft war noch da, obwohl sie beide etwas anderes erwartet hatten; doch das Blut befand sich nicht auf dem Stein, sondern in der Blutrinne eines altertümlich anmutenden Schwerts, welches auf dem Steinblock ruhte. Griff und Parierstangen waren aus geschwärztem Stahl; die breite Klinge hingegen war nicht gerade, sondern leicht gewellt. An jeder Seite bildeten die sich so vier Zacken, zusammen mit der Schwertspitze waren es neun. Das Blut – ihr vereintes Blut – wurde in der Rinne weniger und weniger, bis es völlig verschwunden war; ganz so, als hätte die Klinge es aufgesogen.
»Blutschwester« flüsterte Wulf ehrfürchtig. Er streckte die Hand aus, griff nach der Klinge; vorsichtig berührte er sie. Sie fühlte sich warm an, und vertraut. Er hob das Schwert, wog es in der Hand; trat einen Schritt zurück und vollführte ein paar Streiche in der Luft. Dann umfasste er die Klinge und ließ seine Hand daran hinabgleiten, und die gezackte Schneide ritzte seine Haut. Rotes Blut quoll heraus, doch tropfte nicht zu Boden; die Klinge sog es auf. Und Wulf fühlte wie, sich tief in seinem Inneren ein heiliges Band zur Essenz der Klinge hin streckte und ihre Schicksale aneinander knüpfe. Und er verstand.
-
Sinya bekam von alledem nichts mit. Ihr Blick war auf dem Stein verharrt, als Wulf des Schwert genommen hatte, und unter der Stelle, wo sich Klinge und Parierstangen kreuzten war ein glitzernder Stein verblieben, in welchem sich der Fackelschein sternengleich brach. Es war ein Kristall wie jener, den sie als Auge aus dem Sternbild des Drachen entfernt hatte, als sie vor Äonen die Sternbilder in der Kaverne gelegt hatte. Sie streckte die Hand vor; behutsam ergriff sie den Kristall. Und sie verstand.
-
Sie sahen sich an. Bilder durchwehten ihren Geist, fern und unwirklich, dennoch vertraut; doch viel zu schnell, als das sie alles wirklich in Worte zu fassen vermocht hätten. Vorsichtig verstaute Sinya den Kristall in ihrer Gürteltasche. Wulf umfasste den Schwertgriff mit der Linken; dann reichte er Sinya die Hand, und mit zartem Griff umschlossen sich ihre Finger.
Und der Schleier, der sie vor den Augen ihrer Begleiter verborgen hatte, fiel.
Die Zeit verging. Die schillernde Blase waberte weiter vor sich hin, und nichts wies darauf hin, was darin vor sich gehen mochte. Befand sich das Baronspaar überhaupt im Inneren der Blase? Oder war jene vielmehr nur ein Tor? Jessa wusste es nicht, war unschlüssig, was sie glauben sollte. Larena, Areana und Alcara hatten mit wenigen Worten zu erklären versucht, was das Phänomen alles bedeuten konnte, doch Jessa war es ziemlich gleich. Nach wie vor war sie irritiert, dass ausgerechnet ihre zufällige Berührung das Tor geöffnet hatte; denn weder das innere, soweit es nicht ohnehin von der Blase verdeckt war, noch das äußere des Trollgrabes erinnerten an einen dem Blutigen Schnitter geweihten Ort. Andererseits konnte niemand abschätzen, wie alt das Bauwerk wirklich war, und anhand der Beschaffenheit des Bauwerks erschien nicht einmal mehr sicher, ob es trollischen Ursprungs war. Als ihr das Warten zu lang wurde ließ sie sich an einer Säule im Schneidersitz nieder, legte ihren Nachtwind in den Schoß und versenkte sich in Meditation.
Kilea von Hagenau-Ehrenfeldt erging es ähnlich. Für ihren Geschmack wohnte dem Ort zuviel Magie inne, auch wenn dies noch nicht bewiesen war. Mehrfach umrundete die praiosgeweihte Bannstrahlerin die wabernde Blase, bis sie es nicht mehr in der Kaverne aushielt und das Gefühl bekam, keine Luft mehr zu bekommen. Also verließ sie die Kaverne durch das Tor, schritt den Gang entlang und stieg die Leiter empor. Unter dem Nachthimmel holte sie erleichtert tief Atem und atmete die kühle Nachtluft ein.
Die drei Gelehrten hingegen untersuchten die Kaverne auf ihre Weise mit eher wissenschftlichem Ansatz. Während Hofmagierin Alcara das Geheimnis des Ortes auf magische Weise zu ergründen versuchte, fertigte Larena eine Grundrissskizze des Raumes an, derweil Areana Bellenthor eifrig Notizen in ihr Buch der Schlange schrieb.
Dann, nach Stunden – es musste weit nach Mitternacht sein – wurde das Wabern der Blase mit einem Mal langsamer. Dann zog sie sich etwas zusammen, wurde durchscheinend, breitete sich sodann ruckartig aus. Dabei wurde sie glasklar und zerplatze mit einem leisen ‚plopp‘.
Jessa schreckte aus ihrer Trance auf, als die Blase sich ausdehnte. Sie wollte zurückrutschen, doch in ihrem Rücken befand sich eine der Säulen, die das Innere Rund der Kaverne vom äußeren Gang trennte. Sie spürte Panik in sich aufsteigen, fürchtete, dass die Blase sie verschlingen könnte – doch einen Finger breit vor ihr löste sich die Blase auf und gab den Blick die Mitte der Kaverne frei. Dort befand sich ein Steinblock, und vor jenem stand ihr Schüler und Soldherr, Hand in Hand mit seiner Gemahlin. In der anderen Hand hielt er ein leicht gezackte Klinge.
Jessa sprang auf. Inzwischen hatten auch die drei anderen Frauen bemerkt, dass das Phänomen verschwunden war und eilten auf die Mitte des Runds zu. »Was ist passiert?« Es war – natürlich – Larena, die ihre Neugier kaum zügeln konnte.
»Das kann man kaum in Worte fassen. Eingebungen, Visionen, Traumbilder, so könnte man es wohl benennen«, erwiderte Sinya, und Wulf nickte zustimmend. »Und was ist das da?« Larena wies auf das Schwert.
Jessa sah ihren Glaubensbruder fragend an; Wulf nickte kaum merklich. Dann streckte er ihr die Waffe entgegen.
Jessa trat einen Schritt vor und berührte die Klinge mit den Fingerspitzen. »Blutschwester«, hauchte sie ehrfurchtsvoll.
»Blutschwester? Ist es wahr?« Larena, die sonst wenig beeindruckte, sah die Waffe ehrfurchtsvoll an.
»Eines der acht Schwerter der Goldenen Au. Dem Kor geweiht, ist es nicht so?« Areana zitierte das wenige, was sie über das Schwert wussten.
»Also hast Du gefunden, wonach Du gesucht hast. Kors Klinge, verborgen im Herzen Garetiens.«
»Wir haben es gefunden«, korrigierte Wulf. »Wenn es denn wirklich Blutschwester ist. Es ist eine Heilige Klinge des Herrn der Schlachten, soviel steht außer Frage - doch niemand weiß heuer wahrhaftig, wie Blutschwester ausgesehen hat. Also können wir es nur vermuten, doch solange wir nicht mehr wissen, gehe ich davon aus, das dies hier ist, was wir annehmen.«
»Aber irgendwie ist es schon ein denkwürdiger Zufall, gerade an diesem Ort, den Ihr als Ort der Heerschau auserkoren habt, findet Ihr nicht auch?« Areana, die Hesindegeweihte, sah nachdenklich auf Wulf, dann auf das Schwert.
»Ich verstehe es noch nicht, doch ich denke, wir«, er warf Sinya einen Blick zu, »konnten es nur gemeinsam finden, auch wenn mir die Gründe noch nicht ganz klar sind. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich glaube, ich sollte es finden.«
»Und der Stein dort? Ist das einer dieser legendenumwobenen Altäre?« Wieder war es Larena, die fragte.
Wulf zuckte mit den Schultern. »Das kann sein, muss es aber nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages erfahren. Doch eines ist sicher: Dieser Ort ist wahrhaft der rechte Ort, wie es uns schon die Kunst der Geomantie und alles Wissen gewiesen hat. Wir stehen vor einer Schlacht, und eines der lange verschollenen Schwerter des Königreiches, dem Herrn der Schlachten geweiht, wurde uns an diesem Ort zurückgegeben. Wenn ihr mich fragt, ist dies ein gutes Omen.«
Die Versammelten nickten einmütig. Sinya, die noch immer die Hand ihres Gemahls hielt, drückte diese leicht; die Finger der anderen Hand hingegen formte sie zum Fuchskopf und zeichnete damit, unbemerkt von den Augen der Anderen, das Zeichen Phexens.

| ◅ | Das Innere Sanctum |
|
| ◅ | Das Innere Sanctum |
|
Sternenpfad | ▻ |
| ◅ | Das Innere Sanctum |
|
Himmelsfeuer | ▻ |
Himmelsfeuer
Das Brausen riss die Einwohner Essentals aus dem Schlaf. Nur Noix, der ohnehin nicht viel schlief und oft vor Sonnenaufgang wach wurde, war bereits angekleidet und stand in der offenen Tempelpforte, als die übrigen Bewohner des Lohentempels sich zum ihm gesellten.
»Was passiert hier?« knurrte Razzagh, der offenbar nur schnell in Hose und Stiefel geschlüpft war und sich einen Umhang übergeworfen hatte; sein Fell wärmte ihn aber auch ohne Kleidung besser als die Menschen und Zwerge.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte der Tempelvorsteher. »So etwas habe ich noch nie erlebt. Seht Ihr das Himmelsfeuer? Doch es ist zu früh für das Morgenrot.«
»Das ist nicht das Morgenrot.« Jondra verschränkte die Arme vor der Brust, ihren geweihten Schmiedehammer in der Faust. »Das ist echtes Himmelsfeuer.«
»Himmelsfeuer«, knurrte Razzagh. »Feuer kommt aus dem Inneren der Welt, nicht vom Himmel.« Der orkische Geweihte schnaufte hörbar.
Derweil schwoll das Brausen weiter an, und das unheimliche Feuer am Himmel wurde heller, so als komme es näher. Die nach schien zu brennen – doch nur punktuell.
Noix hielt sich eine Hand über die Augen und versuchte das Gleißen zu durchblicken, dass sich auch vom Schnee des Tales widerspiegelte, doch bald war es so grell, dass er wegschauen musste. Das Grollen war inzwischen so laut, dass man nichts anderes mehr hören konnte.
Mit einem Donnerschlag, gleich so, als ob Ingerimm selbst mit seinem Hammer auf den Amboss schlug, verstummte das Brausen, und das Himmelsfeuer erlosch. Gleich darauf warf ein Windstoß die Geweihten zu Boden, und nur wenig Augenblicke später brach eine Flutwelle über sie hinein und schwappte durch das geöffnete Tempeltor. Zischend verdampfte das Wasser in der Esse; doch das Wasser reichte, um die Glut vollends zu verlöschen.
Entgeistert sahen die Ingerimmpriester sich an und eilten in die Halle hinein. Noix murmelte etwas in der Sprache der Zwerge; »Angrosch sei Dank« wäre wohl die treffendeste Übersetzung gewesen. Das Tempelfeuer war nicht vollends erloschen; die Talglichter entlang der Friese brannten weitestgehend noch, und auch das Feuer in der Lampe des Ingerimmaltars brannte noch.
Das Wasser rann langsam zurück; nur einige Pfützen verblieben auf dem Tempelboden. Noix wandte sich um und trat aus dem Tempel hinaus, die anderen folgten ihm.
Die Landschaft hatte sich schlagartig verändert. Wo zuvor Schnee und Eis die Wiesen bedeckt hatte, waren es nun Matsch und Schlamm zwischen den blassgrüne Halme hervorlugten.
»Heiliges Väterchen«, murmelte Noix.
»Da unten, der See!« Jondra zeigte aufgeregt hinab in die Senke. Das Eis, welches noch am Abend zuvor den See bedeckt hatte, war verschwunden – und die Wasserlinie lag um einiges tiefer, als es selbst in heißen Sommern der Fall war. Der Essensee hatte gut die Hälfte seiner Fläche verloren; statt des Wasser war nur noch schlammiger Seegrund zu sehen.
Ungefähr in der Seemitte dampfte es, feiner Nebel waberte über die Wasseroberfläche dahin. Vorsichtig näherten sich die Geweihten dem Phänomen, wateten dabei bald durch den Uferschlamm. Überall lagen tote Fische im Schlamm, und auch im Wasser dümpelten tote Fischleiber umher.
Razzagh bückte sich und hob einen der Fische auf. Er roch daran, dann zog er dem toten Tier mit einem Ruck die Haut ab.
»Die Fische sind gekocht. Wir können sie einfach einsammeln und essen.« Razzagh dachte wie so oft pragmatisch; manche bezeichneten es als Teil seiner orkischen Natur.
»Später«, erwiderte Noix und drängte sie vorwärts. Also gingen sie weiter; Razzagh grunzte etwas in der Sprache seines Volkes, puhlte etwas von dem Fisch ab und steckte es in den Mund. »Könnte etwas besser gewürzt sein.« Jondra verdrehte die Augen, sagte aber nichts.
Bald waren sie nahe genug herangekommen, um durch den Nebel sehen zu können; zudem befanden sie sich nun an der Wasserlinie. Jesko hockte sich hin, hielt eine Hand in das Wasser und zog sie sogleich zurück. »Ganz schön heiß.«
Aus dem Wasser ragte ein unförmiger Felsbrocken hervor. »Ein Himmelsfels«, sagte Noix beinahe andächtig. »Er hat das Wasser verdrängt und erhitzt, wie es scheint.«
Die anderen Geweihten nickten zustimmend. »Wir sollten ihn bergen.« Jesko sprach aus, was auch Noix schon in Erwägung gezogen hatte.
Der Tempelvorsteher nickte. »Wir warten, bis das Wasser sich abgekühlt hat. Aber dann muss es flott gehen, bevor der See wieder vollläuft.« Er spielte darauf an, dass der See nur einen Zufluss, aber keinen Ablauf hatte; das Wasser lief unterirdisch ab.
»Dann machen wir es so«, sagte Razzagh schmatzend und warf die Gräten des Fisches in den Schlamm. »Und was ist mit den Fischen?«
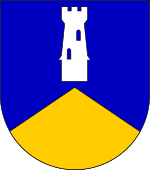
| ◅ | Das heilige Schwert |
|
Der Fischzug | ▻ |
Der Fischzug
Tempel der Jagd zu Hallerstein, 7. Firun 1039 BF, gegen Mittag
Die Nachricht vom Sternenfall in den See hatte sich schnell im Tal herumgesprochen. Aus den umliegenden Dörfern kamen die Menschen, um selbst zu sehen, was passiert war; insbesondere das plötzliche Verschwinden des Schnees und das fehlende Wasser im See sorgte für Aufregung. Die Fische wurden tatsächlich eingesammelt; das beim Einschlag des Himmelsfelsens plötzlich kochende Wasser hatte sie gewissermaßen durchgegart, und im Winter waren sie nun eine willkommene Abwechslung auf dem eher kargen Speiseplan und würden sich ein paar Tage halten.
Auch der Tempel der Jagd, der etwas abseits des Dorfes und Gutsherrnsitzes Hallerstein lag, war mit einem Anteil bedacht worden, den die Dörfler den Geweihten gebracht hatten.
Der Tempel war nicht groß und hatte, wie für ein Haus Firuns nicht unüblich, keine Tempeldiener. So war es an den Geweihten, die täglichen Verrichtungen vorzunehmen, und der Dienst in der Küche oblag an diesem Tag Bärwin von Hallerstein, einem Sohn des Gutsherrn. Zusammen mit Firjan, dem einizgen Novizen, säuberte er nun Teller, Töpfe und Becher. Er hatte den Jungen ins Herz geschlossen und musste oft innerlich lachen, wenn er an die Umstände dachte, die sie verbanden, denn es war ein wenig wie Ritter und Knappe und so zwischen ihrer beider Familien nicht unüblich. Sein Bruder war Knappe am Hof von Firjans Vater gewesen, und nun stand der Junge unter seiner Obhut.
»Ist es nicht eigenartig mit den Fischen?« fragte der Junge, während er einen Stapel hölzerner Tell in ein einfaches Regal stellte.
Bärwin wandte sich um. »Wie meinst Du das?«
»Es ist eigenartig«, erwiderte Firjan. »Da fällt ein Stein vom Himmel in den See, lässt das Wasser verschwinden, und kocht die Fische. Und das, wo es doch diesen Winter schon nur wenig Wild gegeben hat und die Wölfe im Herbst so viele Schafe gerissen haben, das manche Bauern uns doch schon ihr Leid geklagt haben. Ist es nicht wie ein Wunder?«
»Ein Wunder?« Bärwin amüsierte sich etwas über die kindlichen Gedankengänge, wenngleich er selber noch nicht wusste, was er von dem Ereignis halten sollte.
»Oder ein Zeichen. Irgendetwas muss es doch zu bedeuten haben.«
Bärwin warf sich das Tuch über die Schulter, mit dem er gerade den Kessel auswischen wollte, ging vor Firjan in die Hocke und legte dem Jungen die Hände auf die Schultern. »Weißt Du, manche Dinge brauchen Zeit, bis wir sie richtig deuten und verstehen können. Vielleicht ist es ein Zeichen der Götter, vielleicht auch ein böses Omen. Es ist nicht an uns Sterblichen, immer und sofort auf alles eine Antwort zu haben.«
Firjan nickte, auch wenn er noch nicht wirklich verstand, was Bärwin ihm sagen wollte.
»Und nun lass uns eilen; wir müssen uns auch noch um den Fisch kümmern. Am besten, wir ziehen einige auf eine Schnur und hängen sie in den Racuh, dann halten sie länger. Aber vorher zeige ich Dir noch, wie man sie richtig ausnimmt…«

Sterneneisen
Essental, 11. Ingerimm 1039 BF
»Fertig; das war der letzte Rest.« Noix, Sohn des Inoxos, Meister der Esse im Lohentempel von Essental, setzte den großen Schmelztiegel ab und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Es war ihnen tatsächlich gelungen, den Himmelsfelsen aus dem See zu bergen, mit Hilfe der Dörfler und einiger Zugochsen. Schließlich hatten sie den unförmigen Brocken in den Lohentempel geschafft und einer eingehenden Untersuchung unterzogen.
Elf Tage später war der Fels auseinandergebrochen; neben einigen kleinen Bruchstücken und etlichen Splittern waren elf Brocken übriggeblieben. Dort, wo sie vorher miteinander verbunden gewesen waren zogen sich metalische Adern durch das Gestein.
Noix hatte das als ein Zeichen gesehen. Also hatten sie die Felsen behutsam weiter zerkleinert und nach und nach das Metall aus den Gesteinsbrocken herausgeschmolzen. Nun stapelten sich etliche fingerdicke Barren in einer aus Stein gehauenen Truhe, die mit mehreren Schlössern gesichert war.
Noix wartete geduldig, bis dass flüssige Metall in der Gussform fest geworden war. Dann nahm er die große Zange, ergriff damit die Gussform und drehte sie um; das Metall fiel heraus. Wieder tat die Zange ihren Dienst, als er es ergriff und in die große Wanne mit Wasser gab; zischend kühlte das Erz in Efferds Element ab. Nun war es kalt genug, dass er es mit den Händen berühren konnte.
Er nahm es, kramte den Schlüsselbund hervor und öffnete die Truhe. Dann legte er den letzten Barren hinzu und betrachtete die Ausbeute des Himmelsfelsens. Er wusste noch nicht, was sie nun damit anfangen würden, doch es war genug, um einen Schmiedehammer, ein Axtblatt oder gar eine schlanke Schwertklinge davon zu schmieden.
»Sterneneisen«, dachte er, »eine besondere Gabe des feurigen Väterchens.« Er schloss die Truhe. Die Zeiten waren unruhig, da hieß es gut abwägen, was daraus gefertig werden sollte. Und Zeit, die hatte er…
Auf ein neues Jahr
Praiostempel zu Weißenstein, in der Nacht auf den 1. Praios 1040 BF
Rodebrecht von Weißenstein verbrachte die Tage im Tempel. Es war eine Marotte von ihm, der er sich erstmals zu den Namenlosen Tagen nach seiner Weihe hingegeben hatte, denn tief in seinem Inneren fühlte er sich in der Zeit des Jahreswechsels nur im Tempel sicher. So hielt er es auch dieses Jahr. Nach dem Abendmahl am letzten Tage des Rahjamondes begab er sich in den Tempel, versenkte sich in Gebet und Meditation, und verließ die Halle nur, um ein karges Mahl zu sich zu nehmen oder den Abort aufzusuchen. Wenn er nicht ruhte oder ihm die Knochen vom Knien gar zu arge Schmerzen bereiteten las er in den heiligen Bücher oder schritt die Nischen ab, in denen Bilder und Statuen der göttlichen Kinder des Herrn Praios, seiner Alveraniare und Heiligen aufgestellt waren, und hielt stumme Zwiesprache mit ihnen.
Das Tempelrund um den Altar war erleuchtet von etlichen Kerzen, einer Vielzahl der heiligen Zahl Zwölf. Einer Kerze kam dabei eine besondere Bewandtnis zu, denn sie zeigte die Stunden an. Es war bereits die letzte Nacht der Namenlosen Tage, der Jahreswechsel stand unmittelbar bevor. Also linste er immer wieder hinüber zu der Kerze, wann sie endlich bis zu der Kerbe hinabgebrannt war, die Mitternacht und damit den Beginn des neuen Jahres verkündete – den ersten Tag im Monat des Götterfürsten.
Noch nicht. Also kniete er sich erneut nieder, rezitierte die Litanei des Heiligen Praiofold, und als er wieder aufblickte, war das Wachs der Kerze endlich soweit abgeschmolzen, dass die Kerbe nicht mehr zu sehen war, die vom Jahreswechsel kündete. Seufzend erhob er sich, stemmte sich mühsam mit schmerzenden Gliedern in die Höhe. »Herre Praios, sei bedankt für die Zuflucht, die Du Deinem Diener in diesen dunkelsten Tagen des vergangenen Jahres gewährt hast. Gewähre Uns an Diesem Deinem Tage Dein Strahlendes Licht, und gewähre uns Schutz und Segen. Auf ein Neues Jahr!«
Im gleichen Moment durchschlug etwas das Kuppeldach des Tempels, und ein faustgroßer Felsbrocken zertrümmerte ihm den Schädel.

| ◅ | Sterneneisen |
|
Sternenpfad | ▻ |
Sternenpfad
Landgut Ehrenfeldt, 9. Boron 1039 BF, kurz nach Mitternacht
Sie konnte nicht schlafen, schon die dritte Nacht in Folge fand sie keine Ruhe. Sie wälzte sich nach links, dann nach rechts, doch aller Müdigkeit zum Trotz wollten ihr die Augen nicht zufallen. In der ersten Nacht hatte sie sich noch nichts dabei gedacht, auch gestern hatte sie es hingenommen, doch dass es neuerlich wieder auftrat verunsicherte sie. Ob es etwas mit dem Kristall zu tun hatte, den sie im Trollgrab geborgen hatte? Seitdem befand sich sich in diesem Zustand, und inzwischen beschlich sie das Gefühl, irgendetwas vergessen zu haben.
Vorsichtig drehte sie sich zur Seite. Wulf, ihr Gemahl, schlief tief und fest; sein Atem ging ruhig und leise. Behutsam setze sie sich auf und huschte behände aus dem Bett. Im fahlen Licht der Nacht, dass durch die Fenster hereinbrach waren nur die Schemen des unbekannten Zimmers zu erahnen, das der Gutsherr ihnen zugewiesen hatte. Also tastete sie sich vorwärts hin zu der Truhe, in der sie ihre Gewänder abgelegt hatte, ohne wirklich etwas zu sehen - und schließlich stieß sie dagegen.
Sie seufzte, dann murmelte sie leise die Worte Phexens, und augenblicklich erschien ihr das Zimmer wie vom Mondlicht erleuchtet. So nickte erleichtert, so war es besser. Sie öffnete die Truhe einen Spalt weit und tastete nach nach dem kleinen Lederbeutel, in welchem sie den Kristall verstaut hatte. Sie nestelte den Kristall heraus, schloß für einen Moment die Augen, doch sie hatte sich nicht geirrt: Der Kristall leuchtete, wie er es zuvor nie getan hatte - oder vielmehr nicht mehr getan hatte, seit sie ihn in der Grotte im Sternenbild berührt hatte. Doch war das nicht mehr ein Traum, eine Vision gewesen? Noch einmal schloß sie die Augen, konzentrierte sich auf den Kristall, und selbst mit geschlossenen Augen konnte sie das Leuchten erkennen - ein Leuchten, das sie offenbar nur durch die Liturgie wahrzunehmen vermochte, die ihren Blick in der Dunkelheit schärfte. War es ein Zeichen des Nächtlichen, ein verbogener Hinweis?
Leise bewegte sie sich zum Bett zurück und ließ sich im Schneidersitz darauf nieder. Ihre Hände formten sich zu einer Schale, in welcher der Kristall nun ruhte - und plötzlich emporzuschweben schien. Er tanzte wild in der Luft vor ihren Augen herum, hielt abwerben immer wieder inne, so das das Sternbild des Fuchses entstand.
Sinya lächelte. Wie ein Schlüssel öffnete das Bild ihren Geist, und sie ließ die karmale Kraft Phexens fließen, einen Bogen schlagen zwischen sich und dem tanzenden Kristall, einem Sternenschweif gleich, den nur sie sehen konnte. Ein Riss auf ihrer Stirn tat sich auf, und der funkelnde Kristall löste sich aus dem Sternenreigen, schwebte auf sie zu und drang darin ein.
»Der Pfad der Sterne«, flüsterte sie andächtig, und die Worte der Liturgie - intuitiv wusste sie, dass es ebensolche waren - brannten sich in ihren Geist.
Zurück blieb nur eine Narbe, quer inmitten ihrer Stirn, exakt so lang wie ein Augenlid.

| ◅ | Das heilige Schwert |
|
Vielgestaltige Brut | ▻ |
| ◅ | Auf ein neues Jahr |
|
